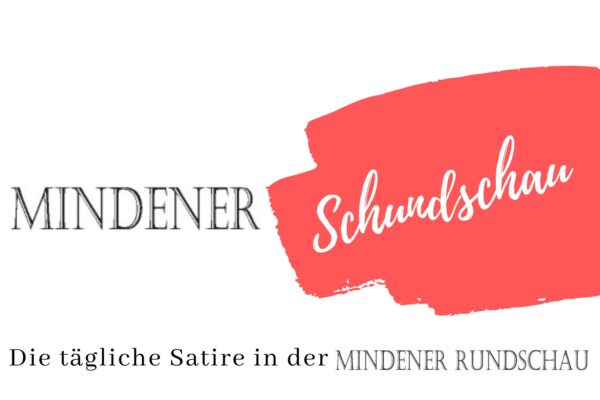Wenn aus Angst vor Worten, die Schere gefordert wird (Kommentar)

Die ARD feierte ihren 75. Geburtstag mit einer großen Jubiläumsshow, die bereits zu Beginn einen Seitenhieb auf die aktuelle Sprachdebatte enthielt. So begrüßte Gast Jürgen von der Lippe die Gäste und Zuschauer mit den Worten „Guten Abend meine Damen und Herren“ und fügte augenzwinkernd hinzu: „Das darf man ja noch sagen“ – eine klare Anspielung auf die Entscheidung der „Tagesschau“, diese traditionelle Anrede in ihren Nachrichtensendungen zu streichen.
Im weiteren Verlauf der Sendung sorgte dann ein Auftritt von Dieter Hallervorden, in dem er in einer Einleitung zu einem alten Sketch die Worte „Negerkuss“ und „Zigeunerschnitzel“ verwendete und suggerierte deshalb inhaftiert worden zu sein, für noch heftigere Diskussionen. Er wandelte damit den berühmten Sketch „Palim, Palim“ um. Die Zeitung „Die Zeit“ bezeichnete in ihrer TV-Kritik Hallervordens Äußerung als „Tiefpunkt des Abends“.
Da die Sendung aufgezeichnet war, fragten sich einige Medien und Zuschauer öffentlich, warum diese Szene nicht aus der finalen Fassung geschnitten wurde. Diese Frage nach nachträglicher Zensur ist mehr als nur eine Randnotiz – sie ist ein Symptom einer gefährlichen Entwicklung für die Kunst- und Meinungsfreiheit,
Warum ist die Forderung nach nachträglicher Zensur so erschreckend?
Es ist in der Tat erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit in der aktuellen Debatte gefordert wird, unliebsame Äußerungen im Nachhinein aus einer aufgezeichneten Sendung zu entfernen. Die Frage, warum die ARD die Sequenz mit Dieter Hallervordens Negerkuss- und „Zigeunerschnitzeleinleitung nicht herausgeschnitten hat, offenbart eine besorgniserregende Tendenz in unserer Gesellschaft und in Teilen der Medienlandschaft. Sie zeugt von einer Denkweise, die offenbar bereit ist, die Prinzipien der Kunst- und Meinungsfreiheit bedenkenlos zu opfern, sobald der Inhalt nicht dem eigenen moralischen Kompass entspricht.
Wer wird zum Zensor und entscheidet über „nicht mehr Zeitgemäßes“?
Diese inquisitorische Haltung, die nach der nachträglichen Bereinigung von Inhalten ruft, ist brandgefährlich. Sie unterstellt, dass eine Redaktion oder ein Sender die Rolle des Zensors übernehmen und im Nachhinein entscheiden soll, was gesagt oder gezeigt werden darf. Wo ziehen wir die Grenze? Wer legt fest, welche Begriffe oder Darstellungen „nicht mehr zeitgemäß“ sind und somit der Tilgung anheimfallen sollen? Die Willkür, die einer solchen Praxis Tür und Tor öffnet, ist offensichtlich.
Gehört Provokation nicht zum Wesen von Kunst und Satire?
Diejenigen, die nun empört fragen, warum die ARD nicht zur Schere gegriffen hat, scheinen zu vergessen, dass gerade die Möglichkeit zur Provokation und zur Überschreitung von Konventionen ein wesentliches Element von Kunst und Satire ist. Hallervordens Auftritt mag als geschmacklos empfunden werden, und löst Diskussionen aus – und das ist auch gut so. Denn eine Gesellschaft, die sich nicht mehr mit unbequemen oder gar anstößigen Inhalten auseinandersetzen will oder kann, verliert ihre Fähigkeit zur Reflexion und zur Weiterentwicklung.
Vergessen wir die Lehren unseres Grundgesetzes?
Die Begründer unseres Grundgesetzes haben die Kunst- und Meinungsfreiheit nicht ohne Grund so umfassend geschützt. Sie wussten um die Bedeutung dieser Freiheiten für eine lebendige und demokratische Gesellschaft. Wer nun im Namen vermeintlicher moralischer Korrektheit die nachträgliche Zensur fordert, sägt an den Grundfesten unserer freiheitlichen Ordnung. Es ist bezeichnend für eine zunehmend ängstliche und überkorrekte Debattenkultur, dass der Ruf nach dem Schnitt so laut erschallt, anstatt sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und die Intention des Künstlers zu hinterfragen – auch wenn diese Intention fragwürdig sein mag.
Diese Debatte macht wirklich Angst
Diese Debatte macht wirklich Angst, weil sie zeigt, wie schnell der Wunsch nach Konformität, der Schnittschere und die Angst vor Kontroversen dazu führen können, dass wir bereit sind, die hart erkämpften Freiheiten unserer Verfassung preiszugeben. Die Frage sollte nicht lauten, warum die Szene nicht herausgeschnitten wurde, sondern vielmehr, warum es Menschen gibt, die eine solche Zensur überhaupt fordern. Denn das ist der wahre Tiefpunkt dieser Debatte.
Bist du der Meinung, dass die Freiheit der Kunst und der Meinungsäußerung verteidigt werden muss, auch wenn es unbequem wird? Oder ist es besser, doch nachtäglich die Schnittschere herauszuholen? Diskutiere mit: Wo verläuft die Grenze zwischen notwendiger Sensibilität und gefährlicher Zensur?
Redaktioneller Hinweis::
Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors wieder und nicht die der Redaktion